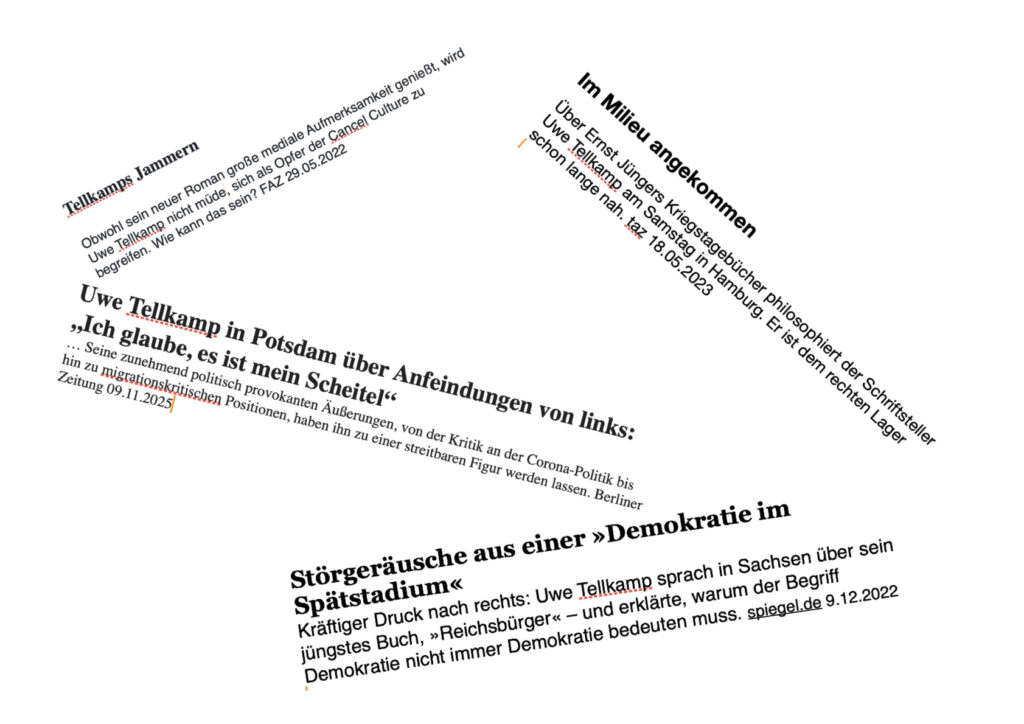Milan Peschel spricht über sein Stück „Sterni und die Astronauten”
.
Von Til Rohgalf
Mit „Sterni und die Astronauten” bringen Milan Peschel und Ensemble Ende Februar ein neues Stück auf die Bühne der M*Halle in Schwerin. Nach einer Heiner Müller-Adaption und zwei Uraufführungen eigener Stücke wird dies Milan Peschels vierte Arbeit für das Mecklenburgische Staatstheater sein – und seine vorerst letzte. Mit „Sterni und die Astronauten” wendet sich das Ensemble der Science Fiction-Philosophie zu.
Milan Peschel sprach vorab mit dem Kulturkompass MV über die Hintergründe und den laufenden Entstehungsprozess des Stückes, über soziale Utopien und natürlich darüber, wie die personellen Umbrüche am Staatstheater die Arbeit beeinflussen.
Wer „Ich werde Dich lieben” oder „Chico Zitrone im Tal der Hoffnung” gesehen hat, der wird in Erinnerung haben, dass diese keinen klaren Handlungssträngen folgten. Es waren absurd-komische, manchmal nachdenkliche, manchmal ironisierende Dialogkunstwerke, die lose um die großen Themen mäanderten, voller Intertextualität und überraschender thematischer Exkurse. „Letztlich”, betont Milan Peschel, „bestehen unsere Stücke aus Gesprächen: zuerst in den Proben, später in den Aufführungen.“

Auch „Sterni und die Astronauten“ arbeitet mit diesen Ingredienzien. Der Aufbruch, die tragikomische „Expedition ins Ungewisse“, ist für den Regisseur ein von außen gegebener Topos: „Der Aufbruch ist uns in diesem Fall zwangsläufig aufgezwungen, weil diese Arbeit für alle Beteiligten die letzte Zusammenarbeit in diesem Kontext sein wird. Nina Steinhilbers [Schauspieldirektorin am Staatstheater, Anm. d. Verf.] Vertrag wurde nicht verlängert, ebenso wie der Großteil der Schauspielerinnen und Schauspieler. Allein deshalb ist es naheliegend, sich mit dem Thema Aufbruch auseinanderzusetzen. Den Abschied haben wir bereits im Stück ‚Ich werde dich lieben’ verarbeitet.“
Milan Peschel (Foto: @ Eva Dieckhoff)
.
Milan Peschel hatte sich in der jüngeren Vergangenheit wiederholt sehr kritisch über die Personalpolitik am Staatstheater im Zuge der Neubesetzung der Schauspielleitung mit Joanna Lewicka geäußert. Die aktuelle Situation fließe somit natürlicherweise als Hintergrundrauschen ein, stehe aber nicht im Mittelpunkt: „Dann würden wir uns selber auch, glaube ich, ein bisschen klein machen und ständiges Thematisieren der Verantwortlichen würde ihnen nur zusätzliche Aufmerksamkeit geben.“ Statt konkreter Personalentscheidungen stehen philosophische Fragestellungen im Mittelpunkt des Interesses. „Sterni und die Astronauten“ ist auch ein Science Fiction-Abenteuer. Das Genre interessiere Milan Peschel schon lange: „Der Titel verweist auch auf Stanisław Lem, einen wissenschaftlich-philosophischen Autor aus dem sozialistischen Polen, der den Krieg als Jude überlebt hat. Er hat in seinen Science Fiction-Romanen sehr klug die Gegenwart verarbeitet und später auch viele philosophische und wissenschaftliche Texte geschrieben. Auch sehr viel Satirisches, wo er über unser gesellschaftliches Zusammenleben reflektierte, auf eine sehr unterhaltsame und auch eine sehr kluge Art.“ Das alles seien Ausgangspunkte, mit denen sich Milan Peschel und das Ensemble auseinandersetzen. „Und in dem Wort ‘Sterni’ steckt ja auch ‘Stern’ drin und ‘Star’, aber auch Billigbier – das Sternburg Pilsener.“
Auch wenn das Stück als „Diskurs“ gemeinsam mit dem Ensemble entsteht, von einer Stückentwicklung möchte der Regisseur nicht sprechen „Das Wort gefällt mir nicht so richtig. Klar entwickeln wir und machen das auch gemeinsam, aber ich bin schon der, der das alles aufschreibt.“ Die Schauspieler*innen seien ebenso Autor*innen wie die Kostüm- und die Bühnenbildnerin, „aber wir fangen mit einem Text an, der von mir mitgebracht wird.” Es gebe ein paar Szenen, die sich dann aber im Laufe der Arbeit verändern. Es sei mehr eine Untersuchung denn eine Entwicklung. „Wir suchen immer eine Startrampe“, beschreibt Milan Peschel die Arbeitsweise. „Ich bezeichne meine Stücke, mit denen ich da ankomme, als ein leeres Regal, das man mit Inhalten füllen kann.“ Auch das gemeinsame Schauen von Filmen diene als Inspirationsquelle. Peschel hebt den sowjetischen Film „Der Weg zu den Sternen” von Pawel Kluschanzew hervor. Dieser Dokumentarspielfilm portraitiert Konstantin Ziolkowski, den Raketenpionier, der sich intensiv mit der Frage beschäftigte, wie man die Schwerkraft überwinden kann. „Und das ist zu einem wichtigen Thema bei uns geworden.“
Der Ausflug ins All sei kein realer Ausweg. Es gehe vielmehr um Perspektivwechsel: „Was die meisten Astronauten ja berichten, wenn sie das erste Mal im All sind, ist, dass sie unseren Planeten als ein ganz fragiles Gebilde wahrnehmen. Das ist vielleicht das Wichtigste daran, wenn man im All ist: dass man merkt, welchen Schatz wir da eigentlich gerade zerstören.“ Der Perspektivwechsel beinhalte aber auch, mit Distanz auf das zu schauen, was man denkt, sich selbst infrage zu stellen. „Quasi eine Form von dialektischem Denken“, führt Milan Peschel aus, „was bei uns gerade auch immer wieder aufploppt.“ Ein Sehnsuchtsort ist das Weltall für Milan Peschel nicht: „Ich finde das eigentlich immer schon eher pervers, darüber nachzudenken, wie man jetzt den Mars besiedelt. Wir haben doch hier alles, ist ja alles da. Hier gibt’s die Luft zum Atmen. Hier gibt’s den Boden, um Pflanzen anzupflanzen, die sogar Menschen ernähren, nicht nur Tiere, die dann von den Menschen gegessen werden.“
Dass das Science Fiction-Abenteuer um Sterni nicht die „Zeit der Utopie” sei, macht der Pressetext zur Inszenierung zwar klar, aber im Gespräch wird Milan Peschel differenzierter: „Ich weiß auch nicht, was die richtige Utopie ist. Ich glaube, das ist relativ langweilig, im Theater auszupinseln.“ Klar sei, dass es „auf jeden Fall nur eine soziale Utopie“, keine technische sein könne – auch wenn es derzeit nur technische Utopien gebe. Das gegenwärtige Fehlen von sozialen Utopien sei systemischen Ursprungs, „weil der Kapitalismus ja nur überleben kann durch permanente Gegenwart. Da gibt’s keine Zukunft und keine Vergangenheit, sondern nur Gegenwart.“ Aus diesem Grund sei der Kapitalismus nicht interessiert an Utopien, „weil Utopien natürlich auch die Einsicht benötigen, dass man bestimmte Sachen nicht mehr unbedingt für sich selber macht, sondern schon für eine nächste Generation. Über sowas möchte ich gerne nachdenken.“
Ohne den hintersinnigen und urkomischen Klamauk, der auch charakteristisch für die letzten beiden Inszenierungen war, ist die Auseinandersetzung mit den großen Themen im Theater für Milan Peschel nicht denkbar: „Du kannst eben keinen Abend über Klimaschutz machen. Das geht nicht. Das fände ich auch abtörnend. Dann belehrt man nur die Leute und nimmt sich auch raus aus dem System, aber man ist ja sowieso Teil davon. Wir sind ja eh alle Teil von der ganzen Scheiße, von den riesigen Klamottenbergen in Afrika. Deshalb halte ich Abstand von thematischen Stückentwicklungen oder Abenden, die mich belehren oder bei denen ich mich belehrt fühle.“
Bei der Realisierung von Utopien sei unser Wirkungsbereich begrenzt. „Aber wenn an einem Abend 140 Menschen im Theater sitzen und gemeinsam mit den 26 Leuten auf der Bühne etwas erleben, gemeinsam nachdenken, lachen, ist das bereits eine Form gelebter Utopie.“ Was uns zusammenhalte, sei keine große Idee, sondern Praxis: Freundlichkeit, Aufmerksamkeit, Gesprächsbereitschaft und die Fähigkeit, andere Haltungen auszuhalten. Es gehe darum, Gräben nicht zu vertiefen, sondern zuzuschütten. Worte allein reichten nicht, es brauche Handeln.
Die gelebte Utopie der freien Theaterlandschaft sieht Milan Peschel vor allem bedroht durch politisch gewollte Sparzwänge in allen Bereichen der Daseinsvorsorge, darunter auch der Kultur- und Bildungspolitik. Für Schauspieler*innen würde es immer schwerer werden, feste Engagements zu finden, weil Ensembles vielerorts reduziert würden. Kulturelle Einrichtungen seien chronisch unterfinanziert – mit fatalen Langzeitfolgen: „Wenn die Leute immer ungebildeter werden und auch Kultur überhaupt keine Rolle mehr spielt, kommen wir irgendwann wieder in die Barbarei zurück.“
In Sachsen-Anhalt strebt die AfD, sollte sie Regierungsverantwortung erlangen, eine „grundlegende Neuausrichtung“ der Kulturpolitik und -förderung an. Bislang lediglich ein verbaler Angriff auf die Vielfalt und Freiheit im Kulturbetrieb, der aber in ähnlicher Weise auch in Mecklenburg-Vorpommern drohen könnte. Milan Peschel, darauf angesprochen, rekurriert auf den Wert des Handelns – für ihn gelte es, weiterzumachen wie immer und „eher noch deutlicher und klarer” zu werden. Die eigene kulturelle Arbeit anzupassen, sich anzudienen, gar ein Theater „auch für rechts“ zu machen, sei keine Alternative: „Ich wüsste nicht, wie ich da noch in den Spiegel schauen sollte.“
Das (Wahl-)Jahr 2026 hat global bereits krisenerprobt begonnen und bleibt ein „Aufbruch ins Ungewisse“ – mit den täglichen Chancen auf gelebte Utopie. Milan Peschels Inszenierung „Sterni und die Astronauten“ scheint für diese Gegenwartserfahrung einen passenden Resonanzraum zu bieten.
Die Premiere von „Sterni und die Astronauten“ ist am 27. Februar in der M*Halle und bereits ausverkauft. Für die Vorstellungen am 8. und 21. März gibt es noch Tickets.
Titel: Milan Peschel (Foto: © Superbass / CC-BY-SA-4.0 (via Wikimedia Commons))
.