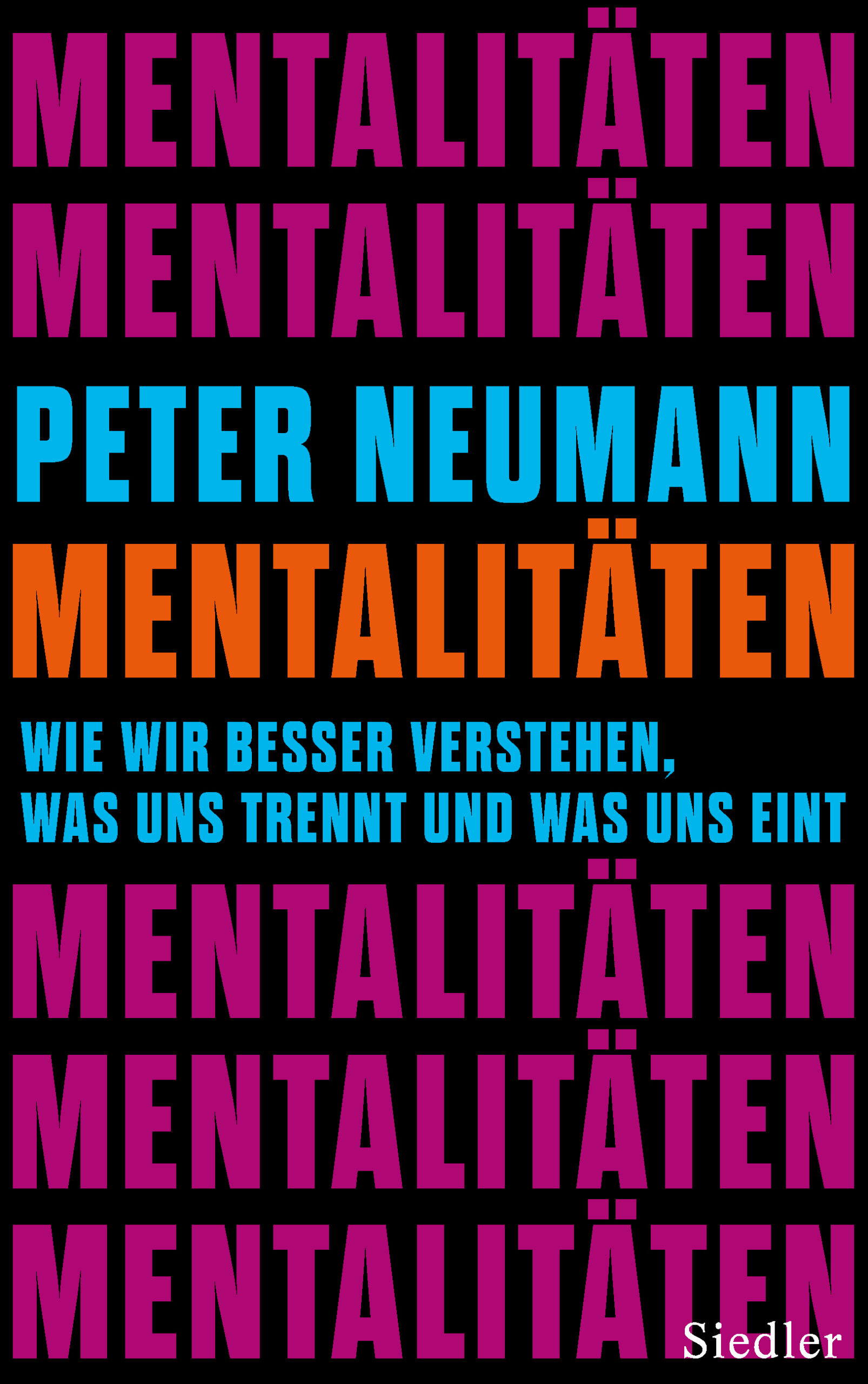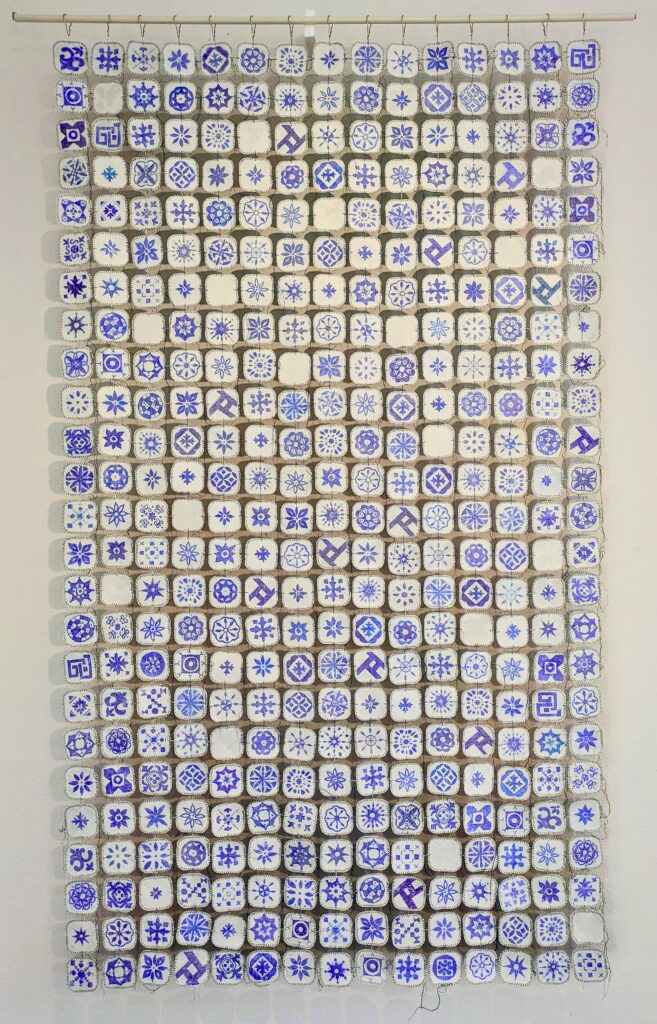Peter Neumanns Abkehr von der Identität erschafft neue diskursive Möglichkeitsräume
.
Von Til Rohgalf
In einer Zeit, in der Diskurse von scharfen Abgrenzungen und polarisierenden Identitäten geprägt sind, rückt der Philosoph Peter Neumann einen Begriff in den Vordergrund, der verspricht, die Atmosphäre unseres Zusammenlebens neu zu vermessen: die Mentalität. Er hat diesem Begriff ein Buch gewidmet, das seine Dringlichkeit auch aus persönlicher Erfahrung bezieht.
Geboren wurde Peter Neumann in Neubrandenburg. Kindheit und Jugend verlebte er in Mecklenburg-Vorpommern. Weitere Lebensstationen folgten, u.a. Jena, Oldenburg und zuletzt Berlin. Rückblickend ist seine Schulzeit im Mecklenburg-Vorpommern der Nachwendejahre mehr von Kontinuitäten denn von Brüchen geprägt. Er spricht in diesem Zusammenhang nicht von Befindlichkeiten, sondern von tief verankerten Erfahrungen – ein „historisches Gepäck“, das wir nicht einfach ablegen können. Dieses Unsichtbare wirke wie eine Stimmung im Raum, schwer zu fassen und doch wirksam, oft klarer in seinen Folgen als in seiner Form.
Jenseits von Klischee und Identitätspolitik
Neumanns Mentalitätsbegriff grenzt sich bewusst von Identitätsdebatten ab. Er ist vielschichtiger zu verstehen als im alltagssprachlichen Kontext. Während Zuschreibungen wie „die Ostdeutschen sind halt so“ oder sportjournalistische Leerformeln („den Dortmundern fehlte in diesem Spiel die richtige Mentalität“) die Welt vereinfachen, will Neumann präziser hinschauen: Mentalitäten sind nach seinem Verständnis kollektive Muster, die sich individuell ausprägen – oft unbewusst. Sie erklären, warum bestimmte Erfahrungen verletzen, warum manche politische Fragen als existenzieller empfunden werden als andere.
Gerade darin liegt der Unterschied zur Identitätspolitik. Die Spaltung von Gesellschaften in Lager und verhärtete Fronten ist eine sichtbare Konsequenz aus dem identitätspolitischen Turn im öffentlichen Diskurs der jüngeren Vergangenheit.
Mentalitäten dagegen sind in Neumanns Lesart durchlässiger. Sie lassen sich nicht auf Kategorien wie Herkunft oder Geschlecht reduzieren, sondern entstehen u.a. aus Generationserfahrungen, Milieus oder historischen Umbrüchen. Anstatt Gräben zu vertiefen, öffnen sie Räume für Verständigung: Man fragt nicht länger, wer dazugehört, sondern warum jemand so empfindet.
Der „romantische Überschuss“
Selten lassen sich Diskurse mit der Suche nach dem besseren Argument hinreichend und adäquat abbilden: Jeder Streit enthalte einen „romantischen Überschuss“, wie es Neumann nennt – die Resonanz persönlicher Geschichte, die unausgesprochene Fracht unserer Mentalitäten. Diese macht uns verletzlich und angreifbar, aber auch nahbar. Wer anerkennt, dass in Auseinandersetzungen immer auch biografische Schichten mitschwingen, gewinnt ein tieferes Verständnis für die Position des anderen. Dass dieser Überschuss regelmäßig von politischen Akteur*innen genutzt wird, um Ressentiments zu schüren und gesellschaftliche oder politische Themen zu emotionalisieren, ist vielleicht die Kehrseite dieser Erkenntnis.
Neumanns deskriptiver Ansatz grenzt sich deutlich von Jürgen Habermas ab – der intellektuellen Referenz des bundesrepublikanischen Selbstverständnisses einer offenen, liberalen Gesellschaft. Habermas’ Diskurstheorie setzt auf das Ideal einer herrschaftsfreien Kommunikation, in der die besseren Argumente zählen und rationale Verständigung möglich wird. Neumann bezweifelt nicht den Wert dieses Ideals, doch er hält es für unvollständig, um die diskursive Wirklichkeit hinreichend zu erklären: In realen Streitgesprächen spielen nicht nur gute Gründe, sondern auch Erfahrungen, Atmosphären und biografische Spezifika eine Rolle. Mentalitäten bringen etwas ins Gespräch, das sich nicht in Logik und Begründung auflösen lässt. Der Streit ist für Neumann nicht nur ein rationaler Austausch, sondern immer auch ein ästhetisches Ereignis – mit Überschuss, mit Pathos, mit Geschichte.
Neumanns eigene Herkunft verdeutlicht das. Wenn der Osten als „No-Go-Area“ abgetan wird oder Bilder eines neuen „Eisernen Vorhangs“ auftauchen, berühre das Kindheitserfahrungen, wie der Philosoph jüngst in einem Interview mit Wolfram Eilenberger bei Deutschlandfunk Kultur ausführte. Solche „Triggerpunkte“ prägen, wie wir über Krieg und Frieden, Stadt und Land oder Freiheit und Sicherheit denken.
Doch Neumann versteht das ausdrücklich nicht als Relativismus. Im Gegenteil: Die „öffnende Funktion“ der Mentalität lädt ein, Erfahrungen zu teilen und mithin Identitäten und Zuschreibungen zu verwässern.
Jenseits von rechten Heimatdiskursen
Die Rede von Mentalität, Prägung oder „Verwurzelung“ gehört zweifellos auch zum Standardrepertoire konservativer und rechter Diskurse. Doch Neumann deutet diese Begriffe liberal und versteht sie als progressiven Möglichkeitsraum: zur Selbstbefragung, zur Verantwortung im Gemeinwesen und zu respektvoller Begegnung. Damit unterscheidet er sich von konservativen Heimat- oder Verwurzelungskonzepten, die Bindung an Boden, Nation und Tradition betonen und Zugehörigkeit exklusiv definieren.
Mentalitäten sind offener. Sie können in Landschaften entstehen, in Milieus oder historischen Brüchen, sie können Heimat einschließen, müssen es aber nicht. Gerade diese Beweglichkeit macht sie anschlussfähig: Wer in einer ostdeutschen Kleinstadt sozialisiert wurde, trägt vielleicht eine andere Mentalität als jemand aus einer westdeutschen Metropole – aber beide lassen sich verstehen und miteinander ins Gespräch bringen.
Zeitenwende der Mentalitäten
Neumann betrachtet nicht nur das Individuum, sondern auch die Bedeutung von Mentalitäten für Gesellschaften: Die Erschütterung der westlichen Demokratien und die Eruption alter Gewissheiten deutet er als eine „Zeitenwende“, die den Westen in sein eigenes „Post-89“ führe. Was im Osten 1989 abrupt geschah – der Übergang vom Sozialismus in die Globalisierung, der Verlust von Industrien, neue Unsicherheiten –, das erlebe der Westen nun selbst, nur langsamer und weniger sichtbar. Was man einst als „Anpassungsstörung“ des Ostens belächelte, betreffe nun alle. Das eröffne die Chance zu einem Dialog auf Augenhöhe.
Die Pluralität in uns selbst
Es gibt nicht die Mentalität, sondern Mentalitäten. Neumann betont, dass jeder Mensch ein variables Geflecht unterschiedlicher Prägungen ist. Diese innere Vielschichtigkeit ist für Neumann mehr Chance zur Selbstbefragung denn Anlass zur Selbstvergewisserung. Sie öffnet zudem den Blick für die Vielschichtigkeit anderer.
Neumanns Konzept ist ein Gegenentwurf zu verhärteter – rechter wie linker – Identitätspolitik. Mentalitäten zeigen auf, was uns unterscheidet, ohne uns unversöhnlich zu trennen. Sie zeigen, was uns verbindet, ohne auf starre Zugehörigkeit zu reduzieren. In einer Zeit, in der Debatten immer härter geführt werden, liegt darin ein unschätzbarer Wert: die Chance auf Verständigung, die nicht spaltet, sondern öffnet.
Am 24.09.2025 erscheint Peter Neumanns Buch „Mentalitäten: Wie wir besser verstehen, was uns trennt und was uns eint“ im Siedler Verlag. Hardcover, 128 Seiten kosten 20 Euro.
.