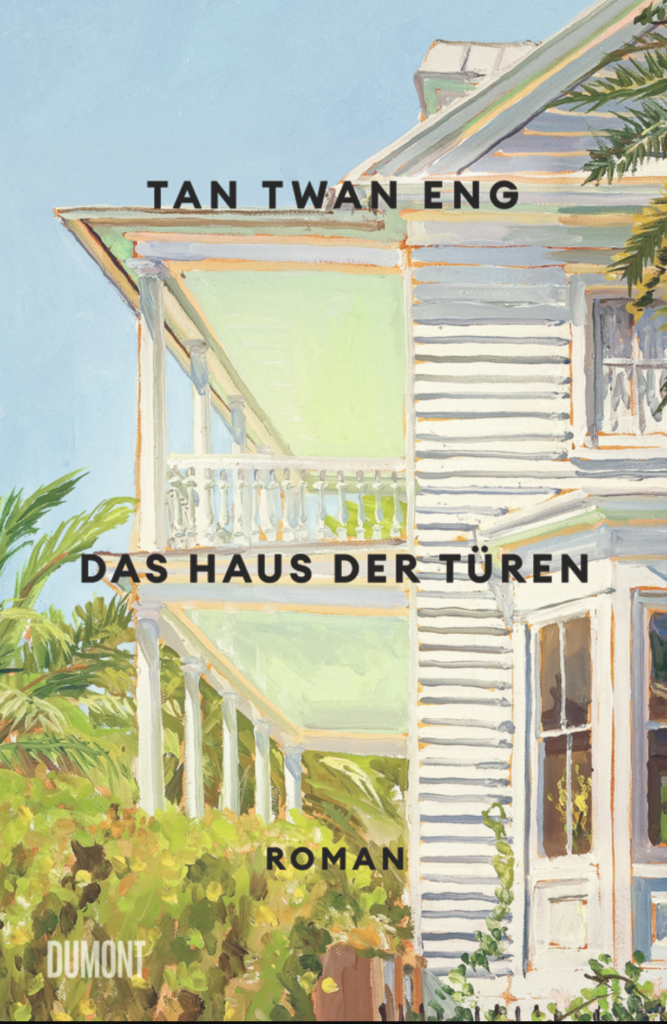Das “Portrait meiner Mutter mit Geistern” in der Schweriner M*Halle
.
Von Christian Franke und Til Rohgalf
Für das Mecklenburgische Staatstheater haben Alice Buddeberg (Regie) und Nina Steinhilber (Dramaturgie) den Roman „Portrait meiner Mutter mit Geistern“ von Rabea Edel für die Bühne bearbeitet.
Worum geht es in dem Stück?
Rabea Edel, die als freie Autorin und Fotografin in Berlin lebt, erzählt in ihrem dritten Roman die Geschichte von Raisa und ihrer Mutter Martha. Es ist keine gewöhnliche – oder vielleicht gerade doch – Erzählung einer Mutter-Tochter-Beziehung. Nachdem Raisa die ersten Jahre ihrer Kindheit mit ihrer Mutter an keinem Ort länger verweilt hat, beginnt sie, nach ihrem Vater zu fragen. Doch Martha schweigt. Es beginnen „Jahre des Schweigens“.
Die Frage nach der Vaterschaft eröffnet eine Familiengeschichte, die sich von der Weimarer Republik bis in die Gegenwart erstreckt. Martha erzählt von ihrer Großmutter Dina, von ihrer Mutter Selma und schließlich von sich selbst. Doch die Erzählung erfolgt nicht offen und linear, sondern bruchstückhaft: Raisa findet kleine Zettel, die zwischen den Ritzen einer Mauer im Hinterhof ihres Hauses verborgen sind. Erst durch das geduldige Zusammensetzen dieser Fragmente entsteht das Bild der Lebenswege dieser Frauen. Raisa erfährt, dass auch Martha ihren eigenen Vater nicht kennt. Was sie jedoch weiß: Sie ist das Kind, das es nicht geben dürfte. Denn Selma, Marthas Mutter, wurde Schreckliches angetan, und ihre Mutterschaft war ungewollt. Auch Selma und Dina schweigen – und mit ihnen gleich mehrere Generationen.

Mit den Fragmenten in der Mauer beginnt Martha jedoch, das Schweigen für Raisa zu brechen. Sie versucht, das Schicksal der ewigen Wiederkehr des Gleichen zu überwinden. Die Muster von Verlust, Trauma, Machtverhältnissen und Erwartungen prägen das Leben der vier Frauen über Generationen.
Auch Jakob, Marthas Vater, versucht seine Erinnerungen zusammenzusetzen und seine Geschichte zu erzählen. Aber er erkennt, dass es ihm unmöglich ist, vom Anfang aus zu berichten. Stattdessen versteht er, dass man das Leben vom Ende her begreifen muss – erst dort wird seine Gesamtheit sichtbar.
Die Sprache des Stücks steckt voller Allegorien, Symbole, Metaphern und Rekurse auf die jüdische Kultur, die durch ihre Form das Motiv der Verhüllung und des Schweigens maßgeblich mittragen. Nichts ist offensichtlich, alles verlangt nach Auslegung – wie das Leben der Protagonistinnen selbst. Wie die Mauer, die für das Schweigen steht, aber gleichsam ein Rekurs auf die Klagemauer in Jerusalem ist.
Alice Buddeberg inszeniert Rabea Edel als Kammerspiel: Die fünf Schauspieler*innen agieren während der gesamten Dauer des Stückes vor einem nahezu statischen Bühnenbild. Dialoge und szenisches Spiel wechseln sich mit narrativen Elementen ab, in denen Textauszüge aus Rabea Edels Roman rezitiert werden. Die Rollenzuweisungen sind dabei von Anfang an nicht eindeutig und fließend: Amina Merai, Jennifer Sabel und Antje Trautmann übernehmen alle weiblichen Rollen – erst durch direkte Anrede wird zuweilen klar, um wen es sich handelt. Diese Uneindeutigkeit verweist auch auf die Parallelität der Schicksale aller weiblichen Protagonistinnen des Stückes: Sie sind gefangen in einem dysfunktionalen System, das von Verletzungen, Traumata und struktureller Gewalt geprägt ist. Zusammengehalten wird dieses System über das Schweigediktat – der Maxime, über das Erlebte nicht zu sprechen.
Diese Schwere und Zwanghaftigkeit, die die familiäre Interaktion generationsübergreifend bestimmt, inszeniert Rabea Edel auf eine für die Zuschauer*innen unmittelbar erfahrbare Weise: Nahezu die gesamte Bühne nimmt ein zum Publikum geneigtes schwarzes Dach ein. Es schützt das Innere der Familienwohnung gegen Blicke von außen, bietet aber keine Möglichkeit des festen und stabilen Stands. Es ist Ausgangspunkt für Sternbeobachtungen. Gleichzeitig versinnbildlicht es die Metapher des „Schwarzen Lochs” im Stück: Der familiäre Ballast, der aufgrund seiner Masse alle (weiblichen) Familienmitglieder an sich zieht und gefangen hält. Dünne Vorhänge, die sich wie Schleier vor die Protagonist*innen auf der Bühne schieben, prägen die erste Hälfte des Stückes ebenso wie eine Videoinstallation, die zunächst eine kaum greifbare Melange aus Störbildern und Fotofragmenten zeigt.

Die fünf Schauspieler*innen, neben den genannten Sebastian Reck und Pepe Röpnack in den männlichen Rollen, bieten dem Publikum vor der Pause keine leichte Kost: sie agieren ruhelos, resigniert, zwanghaft. Handlung und Erzählweise unterliegen, so möchte man meinen, der traumatischen Fragmentierung. Sebastian Reck in der Rolle des Jakob versinnbildlicht diesen Zustand: Er versucht seine täglichen Aufzeichnungen zu einer kohärenten Erzählung zu formen. Erst seine Erkenntnis, man könne „Leben gesund schreiben”, wird zum Schlüsselmoment der Inszenierung.
Regisseurin Alice Buddeberg gelingt es eindrucksvoll, diesen geradezu therapeutischen Prozess inszenatorisch nachzuzeichnen: das Stück gewinnt mit fortschreitender Dauer an Struktur, die Interaktion auf der Bühne wird spürbar lebendiger und ausdrucksstärker; selbst an der Videoleinwand sind zunehmend klare und stabile Bilder zu erkennen.
Alice Buddebergs Stück ist als inszenatorische Traumaarbeit zu lesen: Erst das Sprechen, das kongruente Erzählen, ermöglicht die Integration der fragmentierten Erinnerungen aus der Familiengeschichte mit all ihren unzusammenhängenden Flashbacks. Erst hierdurch werden die Ressourcen frei, sich vom eigenen dysfunktionalen Familiensystem zu emanzipieren.
Für Buddebergs Interpretation von Rabea Edels Roman gab es in der nicht ausverkauften M*Halle lang anhaltenden Applaus. Nicht wenige Gäste sind in der Pause gegangen. Leider, denn ein Theaterabend bis zum Ende lohnt sich – gerade auch wegen der in Teilen sperrigen Inszenierung.
Nächste Vorstellung am 5. Oktober.
Titel: Antje Trautmann, Jennifer Sabel, Pepe Röpnack, Amina Merai (Foto:© Silke Winkler)
Die Autoren: Christian Franke und Til Rohgalf