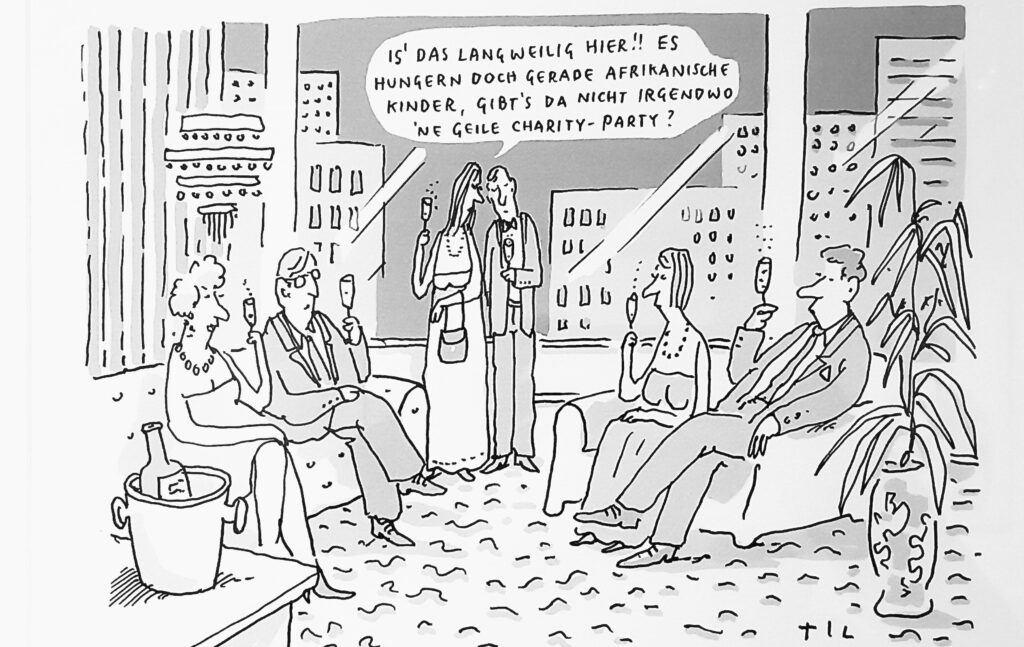„Tage des Exils“ – die kasachische Künstlerin Aïda Adilbek kuratiert ein Kunstfilm-Event in Schwerin
.
Von Til Rohgalf
Zentralasien leuchtet selten auf den europäischen Leinwänden – und noch seltener in Form gesellschaftskritischer Kunstfilme. Die kasachische Künstlerin und Kuratorin Aïda Adilbek bringt in ihrem „Central Asian Moving Image Screening“ im Kunstverein Schwerin ein ganzes Geflecht weiblicher Stimmen zum Sprechen. Im Rahmen der „Tage des Exils“ verwebt sie Bilder, Mythen und Realitäten einer Region, die sich zwischen Aufbruch und Erstarrung neu zu erzählen beginnt. Exil ist hier nicht ausschließlich im Kontext von Vertreibung und Flucht zu verstehen, sondern auch als „Verlust eines ideologisch-kulturellen Bezugsrahmens“. Das Projekt findet parallel zur Fotoausstellung von Cora Pongracz im Kunstverein Schwerin statt.
Dem Kulturkompass gab Aïda Adilbek Einblicke in ihre Filmauswahl.
„Obwohl es viele Filme aus Zentralasien über verschiedene historische und aktuelle Migrationen und Exodi gibt“, so die Kuratorin, „betrachtet diese spezifische Vorführung Exil mehr als eine Form psychologischer Distanzierung oder Isolation in Zeiten des Wandels.“ Die Einfachheit in Cora Pongracz’ Porträts habe sie fasziniert, erzählt sie: „Ich wollte eine ähnliche Haltung einnehmen: Porträts zeigen, aber immer im Dialog mit dem Raum, der Geschichte, der Umwelt.“
Jeder Film gebe, ähnlich wie die Porträts von Cora Pongracz, Einblicke in die Realitäten der Region als Ganzes oder in spezifische Orte, ebenso wie in die Hintergründe der Autorinnen und in die unterschiedlichen Rollen von Frauen im sich ständig wandelnden Kontext Zentralasiens. Das Zurückgenommene, auch in der filmischen Handschrift, ist trügerisch: Hinter den ruhigen Bildern entfaltet sich ein komplexes Narrativ über Exil, verstanden nicht als geografische Vertreibung, sondern als innerer Zustand der Entfremdung – ein Gefühl, das sich zwischen politischen Umbrüchen, ökologischen Krisen und patriarchalen Erwartungen einnistet.

Die filmische Präsentation beginnt mit Soadat Ismailovas Kurzfilm „Her Five Lives“, der eine Periode politischer und sozialer Wendungen der letzten hundert Jahre durch das Bild einer Frau im usbekischen Kino präsentiert. Darin könne man nicht nur die Veränderung des filmischen Stils und der physischen Erscheinungen der Charaktere erkennen, sondern auch die Turbulenzen, die Frauen unter verschiedenen Staatsideologien durchgemacht haben.
Es folgt der Ermina Takenovas Film „Mankurt“, die Interpretation eines Romans von Tschingis Aitmatow: Ein Mann wird versklavt und vergisst seine Geliebten. Die Hauptfigur ist die Mutter des versklavten Mannes: „Ermina konzentriert sich auf diesen traditionellen Mutterfiguren-Erzählstrang, der Schmerz erträgt, bedingungslos liebt und voller innerer Stärke ist, und stellt dieses Bild den Realitäten ökologischer Katastrophen und der in Zentralasien verbreiteten Korruption gegenüber.“
Das Thema Ökologie spielt auch in dem Video „Pole of Inaccessibility“ von Alla Rumyantseva eine zentrale Rolle: „Die Autorin denkt über Energieproduktion und die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf Wasserressourcen nach, was eine wachsende Gefahr in Zentralasien und speziell an den Grenzlinien verschiedener Länder wie Tadschikistan und Afghanistan darstellt, wo Dürre und Wasser zu einem Problem für politische und wirtschaftliche Gerechtigkeit werden könnten.“ Der bildlich im Zentrum stehende Kaffeesatz ist für Aïda Adilbek dabei auch eine Metapher für den Eskapismus in das Vage und Esoterische in Zeiten der Unsicherheit.
Aberglaube, Magie und Alchemie fänden sich auch in Zumrad Mirzalievas Arbeit „Autonomy“, in der ein geteilter Bildschirm zwei Szenen zeigt: ein Kind, das auf Kissen sitzt – ein lokaler Brauch als Wunsch nach Fruchtbarkeit –, sowie Frauen unterschiedlichen Alters, die eine heilige Höhle in Samarkand besteigen, um für eine erfolgreiche Empfängnis zu beten. Die Regisseurin Zumrad Mirzalieva thematisiert in diesem Kontext die Zuweisung und Geltungsmacht von Geschlechterrollen in Zentralasien.
Den Abschluss bildet Aigul Ibrays „Cage“. Ihr Blick auf die gläserne Hauptstadt Astana ist kühl und beklemmend: ein Ort der architektonischen Utopien, die längst in Überwachung und Isolation umgeschlagen sind. Beton, Wind, Leere – die Kamera wird zum Sensor für den mentalen Zustand einer Gesellschaft, die von innen eingesperrt ist. Adilbek sieht in dieser Arbeit eine Metapher für die Gegenwart: „Die neu gebaute Stadt wird zum Spiegel der eingekapselten Leben, der inneren Käfige.“
Das verbindende Moment dieser Arbeiten ist weniger ein gemeinsames Thema als eine Haltung – ein „Pluralismus der Stimmen“, wie Adilbek sagt. In einer Region, in der Filmproduktion oft noch von staatlicher Zensur und bürokratischen Strukturen dominiert wird, bieten Kunstfilme eine seltene Form der Freiheit.
Ein zentrales Anliegen bei der Auswahl der Filme war für Aïda Adilbek, „die konservativen Kriterien des Kinos“ hinter sich zu lassen, wie sie es ausdrückt: „Es geht um neue Stimmen, um das Jetzt.“
In Schwerin sind diese neuen Stimmen noch bis zum 14.11. zu vernehmen: fünf Blicke, fünf Versuche, Vergangenheit und Gegenwart zu begreifen. Der Ausstellungstext verweist hierbei auf historische Parallelen hinsichtlich ähnlicher Erfahrungen systemischer Brüche: „Der Zerfall der UdSSR führte zur Herausbildung neuer Nationalstaaten und zugleich zu Gefühlen von Heimatlosigkeit im eigenen Land. Ein ähnliches Moment findet sich in der DDR-Geschichte: Auch in Ostdeutschland bedeutete der politische Umbruch für viele Menschen den Wegfall eines vertrauten gesellschaftlichen Referenzsystems.“
So fragt sich auch Aïda Adilbek hinsichtlich der Reaktionen des Publikums, „welche kulturellen oder visuellen Bilder das Publikum als am vertrautesten mit ihren Realitäten empfinden kann“.
Das Central Asian Moving Image Screening von DAVRA ist vom 12.11. bis zum 14.11. im Kunstverein Schwerin zu sehen.
Foto: davra community website
.